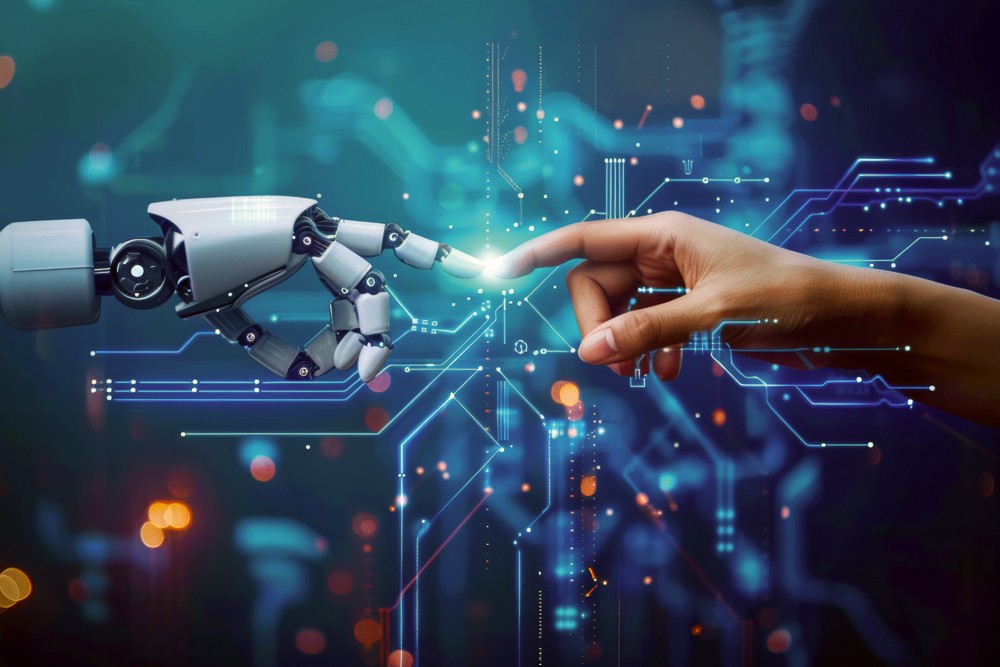
Klarheit im Umgang schaffen
Warum eine KI-Richtlinie für Bäckereien sinnvoll ist
Längst ist künstliche Intelligenz Bestandteil zahlreicher Systeme in der Backstube und im Verkauf. Doch was bedeutet das für das Unternehmen in Sachen Datenschutz, Transparenz und Verantwortung? Die neue EU-KI-Verordnung betrifft jede Bäckerei, sobald sie KI-gestützte Systeme nutzt. Eine betriebsinterne KI-Richtlinie schafft Klarheit und schützt vor rechtlichen Fallstricken.
Mit der Verabschiedung der EU-KI-Verordnung (KI-VO) will die Europäische Union (EU) sicherstellen, dass Künstliche Intelligenz (KI) im Einklang mit europäischen Werten, Datenschutz und Grundrechten eingesetzt wird – und das branchenübergreifend. Auch kleine und mittlere Unternehmen werden einbezogen, sobald sie KI-gestützte Systeme einsetzen, also zum Beispiel auch Bäckereien.
Die Verordnung verfolgt einen risikobasierten Ansatz: Sie betrifft vor allem sogenannte Hochrisiko-KI-Systeme, etwa in der Medizin oder Justiz. Anwendungen im Backbetrieb, wie intelligente Kassensysteme, Absatzprognosen oder Personalplanungstools, fallen in der Regel nicht in diese Kategorie. Dennoch können auch solche Systeme rechtliche Pflichten nach sich ziehen, insbesondere im Hinblick auf Datenschutz und Transparenz. Ob und welche Pflichten im Einzelfall bestehen, sollte juristisch geprüft werden.
KI-Richtlinie formulieren
Um unternehmensintern und bei allen Mitarbeitenden für Klarheit zu sorgen, empfiehlt es sich, in jedem Betrieb eine eigene KI-Richtlinie zu formulieren. Sie sorgt dafür, dass alle über verbindliche Regeln im Umgang mit digitalen Tools verfügen und sich daran orientieren können. Die KI-Richtlinie hilft, Datenschutzrisiken zu minimieren, das Vertrauen von Mitarbeitenden sowie der Kundschaft ins Unternehmen zu stärken und sicherzustellen, dass der KI-Einsatz in der Bäckerei stets im Einklang mit rechtlichen sowie ethischen Vorgaben steht.
Zu diesem Zweck wird in der KI-Richtlinie festgelegt, was erlaubt ist und was nicht und welche Personen in welchen Bereichen die Verantwortung tragen. Anhand acht konkreter Handlungsempfehlungen lässt sich eine eigene KI-Richtlinie erarbeiten, die sich an den jeweiligen Gegebenheiten des Unternehmens orientiert.

Vielfach ist KI bereits in Kassensysteme, Bestellautomation und Personalplanung integriert
1. Nur geprüfte KI-Tools nutzen
Um Sicherheitslücken und rechtliche Risiken zu minimieren, sollten nur solche Tools im Betrieb zum Einsatz kommen, die von fachlicher Stelle, beispielsweise von IT- oder Datenschutzbeauftragten, geprüft wurden und datenschutzkonform arbeiten. Empfehlenswert sind Systeme, deren Anbieter transparent arbeiten und die eine DSGVO konforme Datennutzung gewährleisten. Ein Serverstandort in der
EU kann Vorteile bieten, ist aber keine zwingende Voraussetzung, solange der Datenschutz gewährleistet ist.
2. Einsatzbereiche klar definieren
Um Fehlanwendungen zu vermeiden und den Mehrwert zu erhöhen, empfiehlt es sich, die jeweiligen Einsatzbereiche einer KI-Anwendung klar zu definieren. Beispielsweise kann künstliche Intelligenz in der Bäckerei zur Bestellmengenplanung, für Schichtpläne oder zur Kundenkommunikation genutzt werden – nicht aber zur automatisierten Bewertung von Azubis oder Kündigungsentscheidungen.
3. Keine sensiblen Daten eingeben
Mitarbeitende sollten im Umgang mit sensiblen Daten geschult und mit der KI-Richtlinie zum verantwortungsvollen Arbeiten verpflichtet werden, um nicht gegen Datenschutzgesetze zu verstoßen. So darf man beispielsweise niemals einfach Mitarbeiterdaten, Lohnabrechnungen oder Kundendaten in ein KI-Tool kopieren.
4. Nur geeignete Dokumente hochladen
Festgelegt werden muss daher auch, welche Dokumententypen sich für ein KI-System eignen und welche nicht. Auf diese Weise schützt man sich vor Datenlecks und (unbeabsichtigtem) Geheimnisverrat. Zum Beispiel könnte ein (anonymisierter) Social-Media-Text in ein KI-System hochgeladen werden, ein interner Kostenbericht oder die über Jahrzehnte geschützte Rezeptur des Spezial-Sauerteigbrotes hingegen nicht.

Sobald KI in der Bäckerei zum Einsatz kommt, empfiehlt sich eine eigene KI-Richtlinie im Unternehmen
5. Grenzen setzen
Wesentlich ist, wichtige Entscheidungen nie ohne menschliche Prüfung einer KI zu überlassen. Ein Tool darf Vorschläge machen – die finale Entscheidung, beispielsweise über Personal oder Beschwerden, muss jedoch bei einem Menschen liegen. Auf diese Weise umgeht man ethische Fallstricke.
6. Schulungen durchführen
Unternehmen sind laut KI-VO verpflichtet, die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten durch regelmäßige Schulungen sicherzustellen, insbesondere für Mitarbeitende, die mit KI-Systemen arbeiten. Hierzu eignen sich regelmäßige, praxisnahe Schulungen zum sicheren KI-Einsatz durch eine IHK oder interne Workshops, zum Beispiel für Filialleitungen und die Verwaltung.
7. Verantwortliche benennen
Auch klare Zuständigkeiten für KI-Themen und Tool-Freigaben sollten in einer KI-Richtlinie festgelegt werden. Wer entscheidet, ob ein neues Chatbot-System angeschafft werden darf? Wer prüft rechtliche Aspekte? All das sollte dokumentiert sein und dann auch eingehalten werden.
8. KI-Richtlinie regelmäßig aktualisieren
Die Welt der KI-Systeme entwickelt sich schnell weiter. Ständig entstehen neue Tools und Funktionen. Um die Rechtskonformität sicherzustellen und technologisch stets aktuell zu bleiben, sollte die KI-Richtlinie entsprechend aktueller rechtlicher Vorgaben mindestens jährlich, wenn nicht sogar quartalsweise überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
Sicherheit und Struktur
Ob kleiner Familienbetrieb oder größeres Filialnetz – in Bäckereien nimmt der Einsatz smarter Systeme zu. Schon heute sind viele Prozesse digitalisiert oder teilautomatisiert – ob bei der Bestellung, der Personalorganisation oder der Kundeninteraktion. Wenn dabei KI im Spiel ist, etwa in Form von lernenden Algorithmen oder automatisierten Abläufen, hilft eine KI-Richtlinie dabei, klare Strukturen zu schaffen und allen Beteiligten Sicherheit im Umgang mit künstlicher Intelligenz zu geben.
Die KI-Verordnung schafft dafür einen verbindlichen Rechtsrahmen, der Risiken minimiert und Grundrechte schützt. Wer frühzeitig eine einfache, aber klare KI-Richtlinie etabliert, kann digitale Technologien sinnvoll sowie sicher nutzen und so bewusstes Handeln im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben sicherstellen.
Fotos:
khunkornStudio
Krakenimages-com
Wall Art Galerie


